Individuelle Klimamaßnahmen reichen nicht. Wir schwimmen im überfüllten Schwimmbad, nicht im privaten Badezuber. Systemwandel braucht kollektive Aktion.
Vom Badezuber zum Schwimmbad – warum individuelle Lösungen nicht mehr reichen
Vor drei Jahren hat uns Patrick in einen hölzernen Badezuber eingeladen. Damals stand uns das Wasser bis zum Hals, der Wasserhahn lief unaufhörlich weiter. Patricks Botschaft: Wir müssen den Hahn zudrehen und anfangen, Wasser abzuschöpfen. Dringend.
Heute, im Spätherbst 2025 und während Robert Habeck seine Koffer für Berkeley packt, ist es Zeit für eine unbequeme Wahrheit: Wir sitzen nicht mehr in einem Badezuber. Wir schwimmen in einem überfüllten öffentlichen Schwimmbad – und alle Wasserhähne sind weit aufgedreht.
Illusionen, die der Wirtschaft nutzen
Die Metapher „persönlicher Badezuber“ war verführerisch. Sie suggerierte, dass wir alle unsere eigenen kleinen Klimaentscheidungen treffen können: hier ein bisschen PV-Strom, dort ein E-Auto, dazu noch Bio-Fleisch. Aber diese Individualisierung der Klimakrise folgt einer neoliberalen Logik, die Ulrich Beck bereits in seiner „Risikogesellschaft“ kritisierte: Systemische Probleme werden zu persönlichen Verantwortlichkeiten umgedeutet.
Als Habeck beim tazlab im April sagte, er werde herausfinden, wo er die größte Wirksamkeit erzielen kann, sprach daraus die schmerzhafte Erkenntnis eines Gescheiterten. Die strukturelle Krise Deutschlands lässt sich nicht mit individuellen Maßnahmen lösen – weder von Bürgern noch von einzelnen Ministern.
Darum das neue Setting: Wir befinden uns nicht mehr in Patricks gemütlichem Zuber, sondern in einem öffentlichen Schwimmbad. Die Industrie hat die Hochdruckdüsen aufgedreht, die Landwirtschaft lässt ihre Bewässerungsanlagen laufen, der Verkehrssektor pumpt aus allen Rohren. Einzelne Badegäste schöpfen verzweifelt mit Eimerchen Wasser ab, aber das bewirkt rein gar nichts.
Das ist die banale Realität der Klimapolitik. Der Großteil der globalen Treibhausgasemissionen stammt aus systemischen Quellen: Energieerzeugung, Transport, industrielle Produktion und Landwirtschaft. Der „Carbon Majors Report“ zeigt die Konzentration: Nur 100 Unternehmen sind für 71 Prozent der globalen fossilen Brennstoff- und Zementemissionen seit 1988 verantwortlich. Zwar entstehen 88 Prozent dieser Emissionen erst beim Verbrauch der Produkte – wenn wir Auto fahren oder heizen. Aber die Unternehmen haben diese fossile Abhängigkeit bewusst geschaffen und aufrechterhalten, obwohl sie seit den 1960er Jahren um die Klimafolgen wussten. Und das ganze Theater, während noch viele Menschen über individuelle Verhaltensänderungen wie Plastikstrohhalme oder Fleischkonsum debattieren. Die Verantwortung scheint geteilt, aber die Macht zur systemischen Veränderung liegt vor allem bei denen, die die Infrastruktur kontrollieren.

Reflexion…
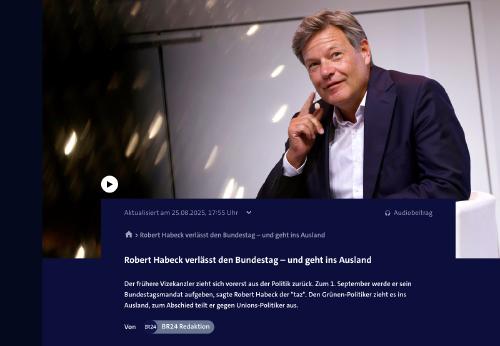
und Scheitern?
Gescheiterter Systemwandel
Robert Habeck hat drei Jahre lang den Versuch verkörpert, einen Systemwandel politisch zu gestalten. Er wollte aus dem Klein-Klein ausbrechen und die deutsche Wirtschaft auf eine neue Grundlage stellen. Doch die Schuldenbremse erwies sich als eiserner Käfig, Habecks „Deutschlandfonds“ blieb ein Papiertiger. Seine Wachstumsinitiative, gedacht als Signal an Industrie und Gesellschaft, dass der Staat bereit ist, die ökologische Modernisierung ernsthaft zu finanzieren, zerschellte am Widerstand der FDP und den selbstauferlegten Fiskalregeln. Habeck wurde zur tragischen Figur: ambitioniert, aber gefangen in einem System, das seine eigene Handlungsfähigkeit leugnet.
Ich glaube, Habeck wird recht behalten: Die Transformation zur Klimaneutralität ist keine Frage individueller Konsumentscheidungen, sondern massiver öffentlicher Investitionen. Und „massiv“ ist richtig; KfW-Research beziffert den Investitionsbedarf für Klimaneutralität in Deutschland auf 500 Milliarden Euro bis 2045.
Die Soziologin Ulrike Herrmann hat es prägnant formuliert: „Grüner Kapitalismus ist eine Illusion“. Solange die Produktionsweise auf Wachstum und Profitmaximierung basiert, werden alle individuellen Sparmaßnahmen durch systemische Expansion zunichtegemacht. Der Rebound-Effekt ist also systemimmanent.
Was folgt daraus?
Erstens: Wir müssen aufhören, Klimaschutz als moralisches Projekt zu rahmen. Es geht nicht um gute oder schlechte Menschen, sondern um Strukturen.
Zweitens: Die notwendigen Veränderungen sind radikal – CO₂-Bepreisung mit sozialem Ausgleich, massive öffentliche Investitionen, Vergesellschaftung der Energieinfrastruktur, demokratische Wirtschaftsplanung.
Drittens: Diese Transformation wird nicht durch Appelle an Einzelne gelingen, sondern nur durch kollektive politische Organisation.
Viertens: Kopf hoch, Krönchen richten: Während die etablierte Politik zaudert, entsteht längst eine Infrastruktur des Systemwandels von unten. Martin Oetting und das Netzwerk Wirtschaft 21 arbeiten an konkreten Transformationspfaden für die Wirtschaft jenseits der Wachstumslogik. Die Climate Hubs von Climate Connect vernetzen lokale Initiativen und machen Klimaschutz zur Gemeinschaftsaufgabe in Städten und Regionen. Der Energiewende ER(H)langen e.V. bringt Bürgerinnen und Bürger zusammen, um die Energieversorgung demokratisch zu gestalten. Und das sind nur einige Beispiele aus unserem Netzwerk der goldenen Herzen – da draußen gibt’s noch sehr sehr sehr viel mehr. Mitmachen lohnt sich!









